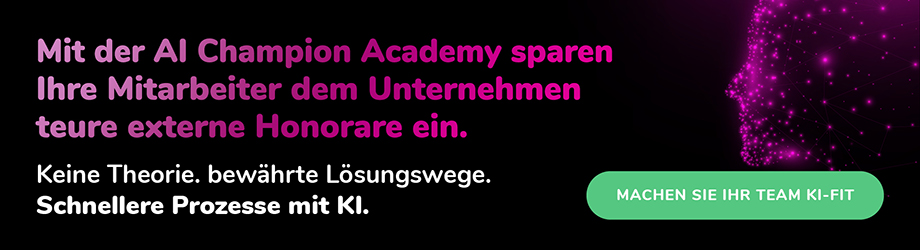EVOPLAST brachte das Kunststoff-Zentrum SKZ, das ZBT in Duisburg und sechs Industrieunternehmen zusammen, um systematische Prüfverfahren für polymerbasierte Komponenten in PEM-Brennstoffzellen zu etablieren. Spezifische In-situ-Methoden zur Detektion von Emissionen in Echtzeit wurden mit Ex-situ-GC/MS-Analysen kombiniert. So konnten medienbeständige und hochreine Kunststoffe mit hervorragender Langzeitstabilität ausgewählt werden. Die gewonnenen Daten tragen zur Senkung von Kosten und Gewicht bei und optimieren industrielle Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette und fördern interdisziplinäre, nachhaltige Partnerschaften.
Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel
Praxisnahe Bewertung von Reinheit, Medienbeständigkeit und Langzeitverhalten polymerer Werkstoffe
Im Rahmen der Projektlaufzeit von Mai 2023 bis April 2025 haben das Kunststoff-Zentrum SKZ und das Zentrum für BrennstoffzellenTechnik (ZBT) in EVOPLAST mit AGC Chemicals Europe, Bürkert Fluid Control Systems, ContiTech Deutschland, Mitsui Chemicals Europe sowie Treffert GmbH & Co. KG kooperiert. Gemeinsam wurden kriterienspezifische Evaluationsverfahren entwickelt, mit denen Medienbeständigkeit, Materialreinheit und Dauerfestigkeit von Polymerwerkstoffen in PEM-Brennstoffzellen unter praxisnahen Betriebsbedingungen systematisch untersucht werden. Die Ergebnisse liefern eine valide Grundlage für gezielte Materialoptimierung.
Brennstoffzellen im Schwerverkehr reduzieren Gewichtsnachteile und verkürzen Betankungszeiten deutlich
Wasserstoffbasierte PEM-Brennstoffzellen wandeln chemische Energie mit einem Wirkungsgrad von über 60 Prozent in Elektrizität um und emittieren dabei nur Wasserdampf. Sie schaffen Synergien mit erneuerbaren Energiequellen, indem sie Stromüberschüsse puffern und bedarfsgerecht freisetzen. Im Mobilitätsbereich bieten sie hohe Reichweiten und kurze Betankungsintervalle für Pkw, Busse, Züge und Schiffe. Durch ihr geringes Gewicht optimieren sie auch die Effizienz von Schwerlast- und Nutzfahrzeugen und sichern stationär zuverlässige Strom- und Wärmeversorgung dauerhaft verfügbar.
Echtzeitbewertung ermöglicht Analyse chemischer Einflüsse auf Zellenspannung und Leistung
In einer innovativen In-situ-Messanordnung des ZBT werden Proben aus technischen Kunststoffen direkt in den Zulauf von Anode bzw. Kathode einer PEM-Brennstoffzelle integriert. Die entstehenden Emissionen werden unmittelbar in eine angeschlossene Sensorzelle geleitet, wo Änderungstrends bei Spannung und Leistungsabgabe kontinuierlich erfasst und ausgewertet werden. Diese Echtzeitbeobachtung erlaubt die gezielte Identifikation potenziell kritisch wirkender Additive und Verunreinigungen, sodass Materialentwickler präzise Rezepturanpassungen vornehmen und den Langzeitbetrieb von PEM-Zellen effizient optimieren optimale Ergebnisse erzielen.
Spezifisches Brennstoffzellen-Testprotokoll entwickelt und anhand GC/MS-Daten standardisiert erfolgreich validiert
Die ex-situ-Untersuchungen mittels Gaschromatographie und Massenspektrometrie ergänzten die In-situ-Messungen und ermöglichten die präzise Erfassung emittierter Verbindungen. Aus den detaillierten Daten zu Identität und Konzentrationsverlauf wurde ein spezifisches Prüfprotokoll für Polymerkomponenten in PEM-Brennstoffzellen abgeleitet. Nach umfassender Validierung garantiert dieses Protokoll eine reproduzierbare, standardisierte Materialbewertung entlang verschiedener industrieller Einsatzszenarien und bildet damit eine verlässliche Grundlage für die Entwicklung robuster Brennstoffzellensysteme. Hersteller können emissionsarme Werkstoffkombinationen auswählen und somit Zelllebensdauer langfristig nachhaltig signifikant verlängern.
Geringe Additivanteile beeinflussen massiv die Degradationsrate und Leistung negativ
Intensive Emissionsmessungen verdeutlichten, dass vermeintlich identische Polymerwerkstoffe unterschiedlichste Abgabemuster zeigten, die Spannungsabfälle von null bis fünfzig Prozent provozierten und bei einigen Proben binnen weniger Stunden zum Totalausfall führten. Schon geringfügige Änderungen in Additiv?oder Füllstoffanteilen beschleunigten den Materialabbau deutlich. Aufgrund dieser Befunde reformulierten die Projektpartner ihre Werkstoffzusammensetzungen und optimierten Vorbehandlungsverfahren, um Emissionen systematisch zu reduzieren und eine beständige Leistungsfähigkeit in Langzeitanwendungen sicherzustellen. Ergänzende Tests validierten die Anpassungen unter realen Betriebsbedingungen erfolgreich.
Unternehmen eingeladen zur Teilnahme im projektbegleitenden Ausschuss für Brennstoffzellentechnik
Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Basis für ein neues IGF-Folgevorhaben von SKZ und ZBT, das fokussiert vertiefte Untersuchungen zu Werkstoffeigenschaften, Grenzflächeninteraktionen und Langzeitstabilität in PEM-Brennstoffzellen umfasst. Neben standardisierten Prüfverfahren werden erweiterte Systemanalysen unter praxisnahen Betriebsbedingungen etabliert. Interessierte Industriepartner sind eingeladen, im projektbegleitenden Ausschuss mitzuwirken, ihre Anwendungserfahrungen zu teilen und gemeinsam nachhaltige, kosteneffiziente sowie leistungsstarke Lösungen für die nächste Generation von Brennstoffzellensystemen zu konzipieren. Dabei fließen Simulationsverfahren und automatisierte Prüfszenarien ein.
Schnelle Markteinführung mobiler stationärer Brennstoffzellensysteme dank umfassender präziser Materialdaten
Die EVOPLAST-Untersuchungen bieten eine systematische Klassifizierung polymerer Werkstoffe für PEM-Brennstoffzellen auf Basis neuartiger Prüfmethoden. Heterogene Emissionsprofile werden analysiert und durch maßgeschneiderte Rezepturoptimierungen beseitigt. So verringern sich unerwartete Spannungseinbrüche, Material- und Gewichtskosten sinken spürbar und die Betriebssicherheit erhöht sich. Standardisierte Bewertungsansätze beschleunigen die Validierung neuer Bauteile und fördern Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette. Damit ebnet das Projekt den Weg für eine CO?-arme Energiezukunft und unterstützt weltweit die effiziente Skalierung zuverlässiger Brennstoffzellensysteme.